BSVÖ: Sichere Schulwege? Blinde und sehbehinderte Kinder im Straßenverkehr.
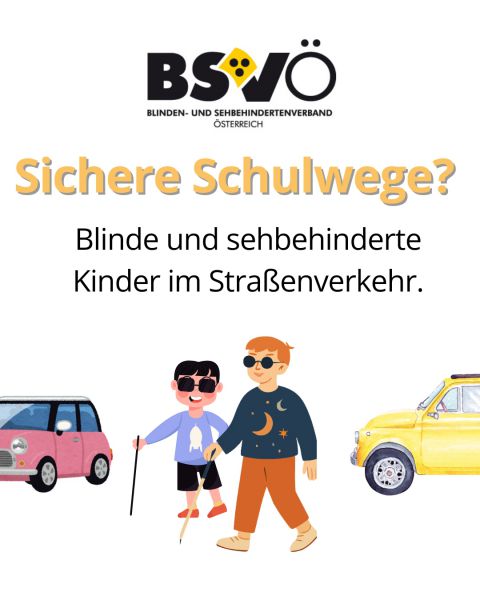
verkehr © BSVÖ
Sichere Schulwege? Blinde und sehbehinderte Kinder im Straßenverkehr. Grafik von zwei blinden Kindern unterwegs
Mit dem Schulbeginn stellt sich auch für blinde und sehbehinderte Kinder eine neue, oft aufregende Aufgabe: alleine den Schulweg in die Schule zu bewältigen. Aber wie sicher sind Kinder mit Sehbehinderungen als Verkehrsteilnehmer:innen unterwegs? Welche Herausforderungen und Gefahren lauern am Schulweg? Und was kann unternommen werden, damit eine sichere und selbstbestimmte Mobilität möglich ist?
Wer selbstbestimmt unterwegs sein will, braucht dafür die richtigen Voraussetzungen. Sichere und übersichtliche Straßenquerungen, Schutzwege, Leitsysteme, akustische Ampeln und ein rücksichtvolles Miteinander. SO kann die problemlose Orientierung und Navigation funktionieren. Die Realität zeigt aber, dass die eigene Sicherheit für blinde und sehbehinderte Menschen nicht immer gegeben ist. Das kann schnell zu brenzligen Situationen führen. Vor allem Kinder mit Sehbehinderungen stellen im Straßenverkehr eine besonders vulnerable Gruppe dar. Noch können Gefahren nicht so gut abgeschätzt werden, weil die Erfahrung fehlt. Und gleichzeitig schränkt fehlende Barrierefreiheit die sichere Mobilität ein.
Bevor blinde und sehbehinderte Kinder alleine unterwegs sein können, werden sie die Strecken gemeinsam mit Erwachsenen kennenlernen. Aber auch auf vertrauten Strecken kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Welche? Wir haben es für Sie zusammengefasst.
Gefahrenquelle Kreuzungen
Kreuzungen, Straßenübergänge, Kreisverkehre, Schutzwege; Sie alle dienen dazu, eine Straße zu queren. Für Menschen, die ihre Umgebung visuell wahrnehmen können, kann es bei ungeregelten Übergängen und schlecht einsichtigen Positionen schon schwierig werden; blinde und sehbehinderte Kinder müssen sich auf weitere Signale verlassen können, um sicher überqueren zu können. Akustische Ampeln, taktile Bodenleitsysteme und lange Ampelphasen steigern die Sicherheit. Fehlen Ampeln gänzlich oder haben Fußgänger:innen gleichzeitig mit Rechtsabbiegern grün, kann das sehr schnell problematisch werden. Gerade Kinder können in diesen Situationen aufgrund ihrer kleinen Körpergröße von rechtsabbiegenden Fahrzeugen schnell übersehen werden. Der BSVÖ setzt sich deswegen seit der Einführung von Rechtsabbiegen bei Rot dafür ein, dass diese Verkehrsregel wieder rückgängig gemacht oder zumindest strenger reglementiert wird.
Gefahrenquelle Ablenkung
Im Straßenverkehr ist höchste Aufmerksamkeit geboten. Blinde und sehbehinderte Kinder, die durch Fremdeinwirkungen oder Geräusche abgelenkt werden, können schneller in Gefahrensituationen geraten. Ruhigere Verkehrslagen sind deswegen weniger problematisch als eine laute Umgebung, dichtes Gedränge und hohes Verkehrsaufkommen.
Gefahrenquelle geräuscharm & rücksichtslos
Eine der größten Gefahren für die sichere Mobilität blinder und sehbehinderter Kinder im Straßenverkehr geht von rücksichtslosen Mitmenschen aus. Vor allem die Verwendung von geräuscharmen Fahrzeugen wie E-Rollern und E-Mopeds, die oft auf Gehwegen, gegen Einbahnstraßen und auf öffentlichen Flächen unterwegs sind, kann zu gefährlichen Zusammenstößen führen. Der BSVÖ appelliert an alle Verkehrsteilnehmer:innen, aufmerksam auf andere zu sein, defensiv zu fahren und die Bedürfnisse anderer Menschen zu respektieren. Und natürlich auch, sich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu halten!
Akustische Ampeln
Akustische Ampelanlagen machen eine Querung für blinde und sehbehinderte Kinder einfacher. Fehlen akustisch wahrnehmbare Signale, ist es mitunter unmöglich, Grünphasen von Rotphasen zu unterscheiden. Liegen an größeren Straßenübergängen, die nicht durch Schutzweg und akustische Ampelanlagen geregelt werden, nehmen viele Kinder weitere Umwege auf sich, um sicher ans Ziel zu kommen.
Taktile Bodeninformationen
Taktile Bodeninformationen (TBIs) helfen dabei, Straßen zu queren und sich auf Gehwegen zu orientieren. Kinder können an ihnen entlang navigieren und hierfür entweder den Langstock verwenden oder die Leitsysteme gehend ertasten. Leitsysteme dürfen nicht verstellt oder beschädigt werden und müssen für die Nutzung durch blinde und sehbehinderte Verkehrsteilnehmer:innen immer freigehalten werden.
Orientierungs- und Mobilitätstraining
Sogenannte O&M-Trainings sind für blinde und stark sehbehinderte Kinder enorm wichtig, wenn es um Sicherheit im Straßenverkehr geht. Es vermittelt Fertigkeiten, mit denen Kinder lernen, sich selbstständig und möglichst gefahrlos im Alltag zu bewegen. Dazu gehört, Geräusche bewusst wahrzunehmen, Entfernungen einzuschätzen und den eigenen Standort zu bestimmen. Mit Hilfe eines Langstocks wird hier geübt, Hindernisse zu ertasten und sich sicher auf Gehsteigen oder über Straßen zu bewegen. Orientierungs- und Mobilitätstrainings stellen ein wichtiges Werkzeug für die sichere und selbstbestimmte Mobilität dar.
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit für sichere Mobilität
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) arbeitet als unabhängige Organisation daran, Unfälle zu reduzieren und öffentliche Räume sicherer zu machen. Durch technische Richtlinien, Forschung, Bewusstseinsarbeit und konkrete Pilotprojekte wie 3D-Zebrastreifen oder barrierefreie Begehungen trägt es auch dazu bei, Gefahren im Straßenverkehr für blinde und sehbehinderte Erwachsene und Kinder zu mindern.
Augen auf, Ohren auf!
Der BSVÖ steht in engem Austausch mit dem KFV, das sich auf vielen Ebenen auch für die Sensibilisierung für die Probleme, denen blinde und sehbehinderte Verkehrsteilnehmer:innen gegenüberstehen, einsetzt.
So wurde gemeinsam mit dem ORF eine neue Helmi-Folge entwickelt, in der sich alles um die Verkehrssicherheit eines blinden Mädchens dreht. Wie Helmi aus seinem Raumschiff heraus die oft brenzligen Situationen wahrnimmt und wie diese vermieden werden können, zeigt die Helmi-Spezialfolge, die kurz vor dem Tag des Weißen Stocks im ORF ausgestrahlt wird.
